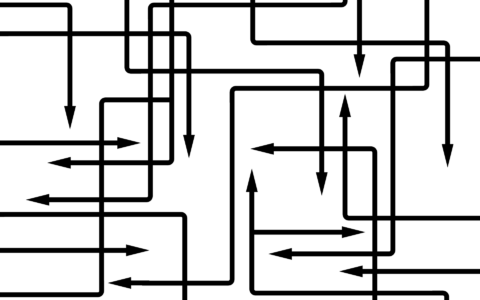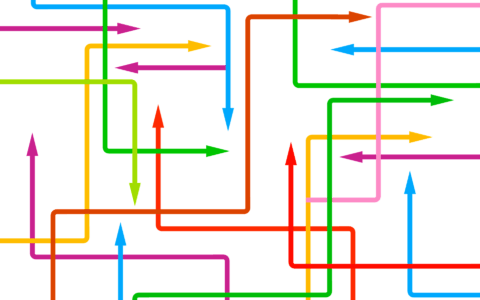Eine Möglichkeit der außergerichtlichen Konfliktschlichtung ist der Täter-Opfer-Ausgleich. Dabei müssen sowohl Täter als auch Opfer mit dieser Verfahrensweise einverstanden sein. Außerdem ist es erforderlich, dass der Täter sich zu seiner Tat bekennt.

Ein Täter-Opfer-Ausgleich wird vor allem bei Jugendlichen praktiziert, aber auch bei Erwachsenen kann diese Art der Schlichtung herangezogen werden. Für den Täter-Opfer-Ausgleich kommen allerdings nur bestimmte, leichte Straftaten in Betracht. So wird z.B. bei Vergewaltigung ein Täter-Opfer-Ausgleich nicht angewendet. Geregelt ist der Täter-Opfer-Ausgleich in den §§ 155a, 155b StPO und in § 46a StGB. Gesonderte Vorschriften gibt es für die Jugendlichen: § 45 JGG.
In einigen Bundesländern läuft ein Pilotprojekt, bei dem bestimmte Aspekte des Täter-Opfer-Ausgleichs mit einbezogen worden sind: das Schülergericht.
Wie ein solcher Täter-Opfer-Ausgleich abläuft, ist unterschiedlich. Ein festes Verfahren gibt es hierfür nicht. Wie bei einer Mediation gibt es einen Vermittler, der als unparteiische Person beide Seiten unterstützt, berät und motiviert. Deshalb wird der Täter-Opfer-Ausgleich auch Mediation im Strafrecht genannt – auch wenn es sich methodisch nicht um eine Mediation handelt.
Revolutionär bei dieser Methode ist die Gleichgewichtung des Opfers und des Täters. Nicht nur die Strafverfolgung und Ahndung der Tat ist wichtig, sondern auch die Opferinteressen, wie z.B. die Wiedergutmachung oder die Verarbeitung des Geschehenen bis zum Verstehen der Tat. Der Täter lernt die Perspektive des Opfers kennen und das Opfer erfährt etwas über die Sichtweise des Täters.
Die Beschuldigten und die Geschädigten führen Einzelgespräche, in denen mit Hilfe des Vermittlers das gemeinsame Ausgleichsgespräch vorbereitet wird. Während des Ausgleichsgesprächs hilft der Schlichter bei der Tataufarbeitung und Findung von Lösungsmöglichkeiten für die Straftat, mit der beide Beteiligten einverstanden sind. Diese gemeinsam gefundene Lösung wird verbindlich in schriftlicher Form festgehalten. Es wird ein Vertrag über diese Wiedergutmachungsvereinbarung geschlossen, der seitens der Vermittler auch auf ihre Einhaltung hin überprüft wird.
Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht bekommt vom Vermittler einen Bericht über den Täter-Opfer-Ausgleich. Dieser kann sich strafmildernd auswirken oder sogar eine Einstellung des Verfahrens bewirken.
Allerdings ist dieser Täter-Opfer-Ausgleich nicht ganz unproblematisch: So ist zum Zeitpunkt des Anstoßens des Täter-Opfer-Ausgleichs durch die Staatsanwaltschaft noch nicht rechtskräftig festgestellt worden, dass und ob der Beschuldigte zweifelsfrei der Täter ist. So könnte sich der Beschuldigte allein um z.B. die Hauptverhandlung zu umgehen, sich mit dem Täter-Opfer-Ausgleich einverstanden erklären. Genauso kann sich der Geschädigte ausgenutzt vorkommen, wenn der Eindruck entsteht, der Beschuldigte habe dem Täter-Opfer-Ausgleich nur zugestimmt, um eine Verfahrenseinstellung zu erreichen.
Gerade um diesen Missbrauch zu verhindern, ist eine Unterstützung in Form des Vermittlers bei dem Täter-Opfer-Ausgleich unbedingt erforderlich. Nur so kann es eine faire und gerechte Vereinbarung geben, mit der beide Parteien leben können.