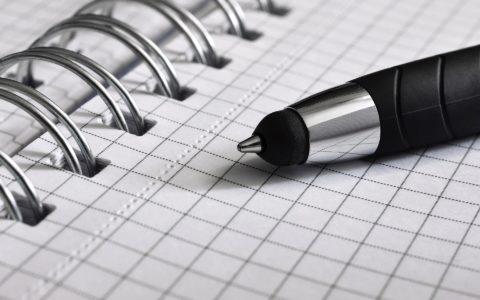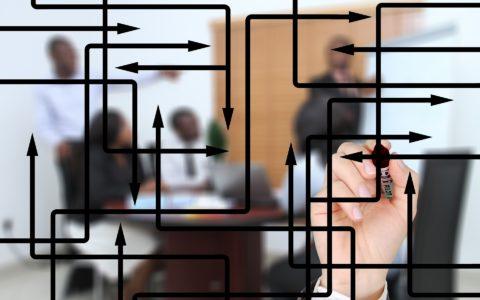Um eine Hemmung der Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB bewirken zu können, muss in Anlageberatungsfällen der Güteantrag regelmäßig die konkrete Kapitalanlage bezeichnen, die Zeichnungssumme sowie den (ungefähren) Beratungszeitraum angeben und den Hergang der Beratung mindestens im Groben umreißen. Ferner ist das angestrebte Verfahrensziel zumindest soweit zu umschreiben, dass dem Gegner und der Gütestelle ein Rückschluss auf Art und Umfang der verfolgten Forderung möglich ist; eine genaue Bezifferung der Forderung muss der Güteantrag seiner Funktion gemäß demgegenüber grundsätzlich nicht enthalten.

Ein Güteantrag hemmt die Verjährung ohne die nötige Individualisierung des geltend gemachten prozessualen Anspruchs nicht; diese kann nach Ablauf der Verjährungsfrist auch nicht mehr verjährungshemmend nachgeholt werden[1]. Damit der Eingang eines Güteantrags gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 BGB aF eine Hemmung der Verjährung bewirken kann, muss dieser zum einen die formalen Anforderungen erfüllen, die von den für die Tätigkeit der jeweiligen Gütestelle maßgeblichen Verfahrensvorschriften gefordert werden, und zum anderen für den Schuldner erkennen lassen, welcher Anspruch gegen ihn geltend gemacht werden soll, damit er prüfen kann, ob eine Verteidigung erfolgversprechend ist und ob er in das Güteverfahren eintreten möchte[2]. Dabei sind einerseits keine zu strengen Anforderungen zu stellen, andererseits ist aber auch zu berücksichtigen, dass der Antrag an die Gütestelle als neutralen Schlichter und Vermittler gerichtet wird und diese zur Wahrnehmung ihrer Funktion ausreichend über den Gegenstand des Verfahrens informiert werden muss[3].
In Anlageberatungsfällen muss der Güteantrag daher – wie auch das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat – regelmäßig die konkrete Kapitalanlage bezeichnen, die Zeichnungssumme sowie den (ungefähren) Beratungszeitraum angeben und den Hergang der Beratung mindestens im Groben umreißen. Ferner ist das angestrebte Verfahrensziel zumindest soweit zu umschreiben, dass dem Gegner und der Gütestelle ein Rückschluss auf Art und Umfang der verfolgten Forderung möglich ist; eine genaue Bezifferung der Forderung muss der Güteantrag seiner Funktion gemäß demgegenüber grundsätzlich nicht enthalten[4].
Nach diesen Maßstäben ist der Güteantrag des Anlegers in dem hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall nicht hinreichend bestimmt: Es sind dort lediglich neben anderen Beteiligungen die vorliegend streitige Kapitalanlage und – abstrakt – das angestrebte Verfahrensziel hinreichend mitgeteilt. Dagegen fehlen Angaben zur Zahlungssumme, und der Hergang der Beratung ist unzureichend sowie, insbesondere hinsichtlich der Person des Beraters, völlig anders dargestellt, als dies nunmehr geltend gemacht wird; der (ungefähre) Beratungszeitraum ist falsch angegeben. Das Fehlen dieser Angaben ist entgegen der Annahme der Vorinstanz nicht unerheblich.
Die Zahlungssumme ist im Güteantrag anzugeben, weil durch sie maßgeblich die Höhe des Schadens bestimmt wird und damit von ihr das konkret angestrebte Verfahrensziel abhängig ist. Ohne diese Angabe ist für den Antragsgegner der geltend gemachte Schaden nur mit Hilfe weiterer Ermittlungen, für die Gütestelle hingegen gar nicht einzuschätzen[5]. Die Gütestelle soll auf der Grundlage des ihr unterbreiteten Sachverhalts den Parteien einen Vergleichsvorschlag unterbreiten. Dies ist ihr ohne Kenntnis der Schadenshöhe jedoch nicht möglich[6]. Warum das Berufungsgericht diese Angabe entgegen der vorzitierten höchstrichterlichen Rechtsprechung für entbehrlich erachtet hat, hat es nicht begründet.
Angaben zum Hergang der Beratung sind erforderlich, um es dem Antragsgegner zu ermöglichen, seine Erfolgsaussichten zu prüfen und zu entscheiden, ob er in das Güteverfahren eintreten möchte. Wird eine Kapitalanlage – wie hier – im Strukturvertrieb vertrieben, muss es der Güteantrag dem Antragsgegner ermöglichen zu ermitteln, um welche Anlageberatung es im vorliegenden Fall ging[7].
Auch diesen Anforderungen genügte im hier entschiedenen Fall die Darstellung im Güteantrag nicht: Dort ist ausgeführt, der Geschäftsführer der beklagten Anlageberaterin habe die Eigenschaften und Risiken des Fonds mit fehlerhaften Verkaufsunterlagen beschrieben und die Fehlerhaftigkeit im Rahmen der mündlichen Beratung nicht klargestellt. Er habe nicht darauf hingewiesen, welche Risiken mit der Beteiligung verbunden seien; insbesondere sei ein Hinweis auf die fehlende Möglichkeit ihres Verkaufs nicht erfolgt. Das insinuiert, dass Ansprüche wegen Prospektfehlern geltend gemacht würden. Dies ist indes nicht der Fall. Der Anleger behauptet vielmehr, ein Prospekt sei ihm nicht übergeben worden; er hat auch nicht vorgetragen, die Beratung – durch den Zeugen L. – sei unter Verwendung eines Prospekts erfolgt. Zu dem konkreten Beratungshergang, aus dem der Anleger seine Ansprüche wegen der vorliegend streitigen Beteiligung herleitet, weist der Güteantrag keinen Bezug auf. Es fehlt darin jede Angabe dazu, was dem Anleger gesagt worden sei; es wird lediglich – unterschiedslos für alle fünf Beteiligungen – dargestellt, worüber der Anleger nicht aufgeklärt worden sei. Unabhängig davon kommt vor allem hinzu, dass der Anleger in Bezug auf die dem Rechtsstreit zugrundeliegende Beteiligung an der „Dr. U. A. KG“ falsch angegeben hat, vom Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft (statt vom Berater L.) beraten worden zu sein.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 1. Oktober 2020 – III ZR 60/19
- vgl. zB BGH, Urteil vom 18.06.2015 – III ZR 198/14, BGHZ 206, 41 Rn. 17 mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 18.06.2015 aaO Rn. 21 f[↩]
- vgl. BGH, aaO Rn. 24 mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 18.06.2015 aaO Rn. 25; vom 20.08.2015 – III ZR 373/14, NJW 2015, 3297 Rn. 18; vom 03.09.2015 – III ZR 347/14 17; und vom 15.10.2015 – III ZR 170/14, NJW-RR 2016, 372 Rn. 17; Bundesgerichtshof, Beschlüsse vom 16.07.2015 – III ZR 164/14 3 und – III ZR 302/14 5; vom 13.08.2015 – III ZR 358/14 3 und – III ZR 380/14 14; und vom 28.01.2016 – III ZB 88/15, WM 2016, 403 Rn. 16[↩]
- vgl. hierzu BGH, Beschluss vom 28.01.2016 aaO Rn. 17; vgl. auch BGH, Urteil vom 06.12.2016 – XI ZR 257/15 40[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 18.06.2015 aaO Rn. 28[↩]
- vgl. BGH, aaO Rn. 27[↩]