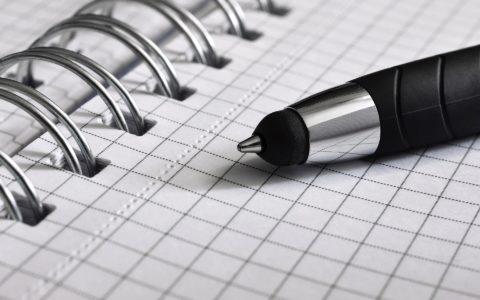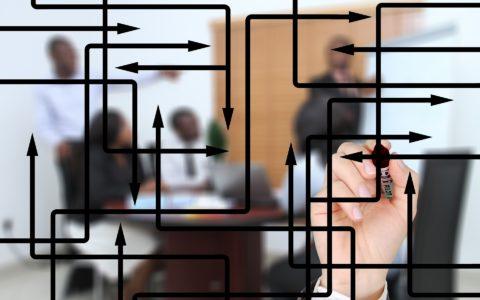Die Aufhebung eines Parteiausschlusses durch ein Gericht, die unter Verkennung der insofern eingeschränkten Kontrolldichte staatlicher Gerichte erfolgt, verletzt das Willkürverbot.

Ein Richterspruch verstößt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dann gegen den allgemeinen Gleichheitssatz in seiner Ausprägung als Verbot objektiver Willkür (Art. 3 Abs. 1 GG), wenn er unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar ist und sich daher der Schluss aufdrängt, dass er auf sachfremden Erwägungen beruht. Das ist anhand objektiver Kriterien festzustellen. Schuldhaftes Handeln des Richters ist nicht erforderlich. Fehlerhafte Rechtsanwendung allein macht eine Gerichtsentscheidung nicht objektiv willkürlich. Schlechterdings unhaltbar ist eine fachgerichtliche Entscheidung vielmehr erst dann, wenn eine offensichtlich einschlägige Norm nicht berücksichtigt, der Inhalt einer Norm in krasser Weise missverstanden oder sonst in nicht mehr nachvollziehbarer Weise angewendet wird[1].
Nach dieser Maßgabe verletzt das der Berufung des X. stattgebende Urteil des Kammergerichts die SPD in ihrem Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG. Der angegriffene Beschluss verkennt die eingeschränkte Kontrolldichte staatlicher Gerichte im Rahmen der Überprüfung schiedsgerichtlicher Parteiausschlüsse gemäß § 10 Abs. 4 PartG in unvertretbarer Weise.
Bei der Überprüfung von Entscheidungen der Parteischiedsgerichte durch staatliche Gerichte sind der Grundsatz der Parteienfreiheit des Art. 21 Abs. 1 GG und die verfassungsrechtlich verbürgten Rechte der von der Maßnahme betroffenen Parteimitglieder jeweils angemessen zur Geltung zu bringen. Die vom Grundgesetz vorausgesetzte Staatsfreiheit der Parteien erfordert nicht nur die Gewährleistung ihrer Unabhängigkeit vom Staat, sondern auch, dass die Parteien sich ihren Charakter als frei gebildete, im gesellschaftlich-politischen Bereich wurzelnde Gruppen bewahren können. Der Prozess der Meinungs- und Willensbildung des Volkes muss grundsätzlich „staatsfrei“ bleiben[2]. Die Parteienfreiheit umfasst die freie Wahl der Rechtsform, der inneren Organisation sowie der Zielsetzung einschließlich Name, Satzung und Programm, die Teilnahme an Wahlen sowie die Verfügung über Einnahmen und Vermögen[3]. In personeller Hinsicht verbürgt sie die freie Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern bis hin zur Selbstauflösung der Partei und der Vereinigung mit anderen Parteien[4].
Hieraus folgt eine eingeschränkte Kontrolldichte der staatlichen Gerichte bei der Überprüfung der Entscheidungen von Parteischiedsgerichten. Es ist nicht Sache der staatlichen Gerichte, über die Auslegung der Satzung und der bestimmenden Parteibeschlüsse zu entscheiden. Die Einschätzung, ob ein bestimmtes Verhalten einen vorsätzlichen Verstoß gegen die Satzung oder einen erheblichen Verstoß gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei bedeutet und der Partei damit schwerer Schaden zugefügt wurde (§ 10 Abs. 4 PartG), ist den Parteien vorbehalten[5].
Andererseits steht auch dem einzelnen Mitglied einer Partei die Betätigungsfreiheit des Art. 21 Abs. 1 Satz 2 GG zu. Daher bleiben die staatlichen Gerichte zur Missbrauchs- und Evidenzkontrolle verpflichtet, soweit der Gesetzgeber privatautonome Streitbereinigung durch Schlichtungsgremien zulässt[6]. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs prüfen die staatlichen Gerichte daher (nur), ob die durch ein Parteischiedsgericht verhängte Maßnahme eine Stütze im Gesetz oder in der Parteisatzung findet, das satzungsgemäß vorgeschriebene Verfahren beachtet, sonst kein Gesetzes- oder Satzungsverstoß vorgekommen und die Maßnahme nicht grob unbillig oder willkürlich ist sowie ob die der Entscheidung zugrundeliegenden Tatsachen ordnungsgemäß festgestellt worden sind[7].
Dabei ist eine Bindung eines Parteischiedsgerichts an den Verzicht auf einen Ausschluss anderer Parteimitglieder allenfalls dann in Betracht zu ziehen, wenn dem ein im Wesentlichen gleichgelagerter Sachverhalt zugrunde liegt[8]. Fehlt es am Vorliegen eines solchen gleichgelagerten Sachverhalts, ist der Nichtausschluss anderer Parteimitglieder von vornherein ungeeignet, die grobe Unbilligkeit einer getroffenen Ausschlussentscheidung zu begründen[9].
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 27. Mai 2020 – 2 BvR 121/14
- vgl. BVerfGE 89, 1, 13 f.; 96, 189, 203, stRspr[↩]
- vgl. BVerfGE 20, 56, 99 ff.; 85, 264, 287[↩]
- vgl. BVerfGE 73, 40, 85 f.; 104, 14, 19, 22; 111, 382, 409[↩]
- vgl. BVerfG, Beschluss vom 28.03.2002 – 2 BvR 307/01 13; Kunig, in: v. Münch/ders., GG, Bd. 1, 6. Aufl.2012, Art. 21 Rn. 45[↩]
- vgl. BVerfG, Beschluss vom 28.03.2002 – 2 BvR 307/01 14; siehe auch: BGHZ 75, 158, 159; BGH, Urteil des 2. Zivilsenats vom 14.03.1994 – II ZR 99/93 11[↩]
- vgl. BVerfG, Beschluss vom 28.03.2002 – 2 BvR 307/01 15, m.w.N.[↩]
- vgl. BGHZ 87, 337, 343 ff.; BGH, Urteil des 2. Zivilsenats vom 14.03.1994 – II ZR 99/93 11[↩]
- vgl. Bull, DVBl 2014, S. 262, 264; Roßner, in: Morlok/Poguntke/Sokolov, Parteienstaat – Parteiendemokratie, 2018, S. 95, 117; siehe zum Vereinsausschluss allgemein BGHZ 47, 381, 385 f.[↩]
- vgl. Bull, DVBl 2014, S. 262, 264[↩]
Bildnachweis:
- SPD: SPD